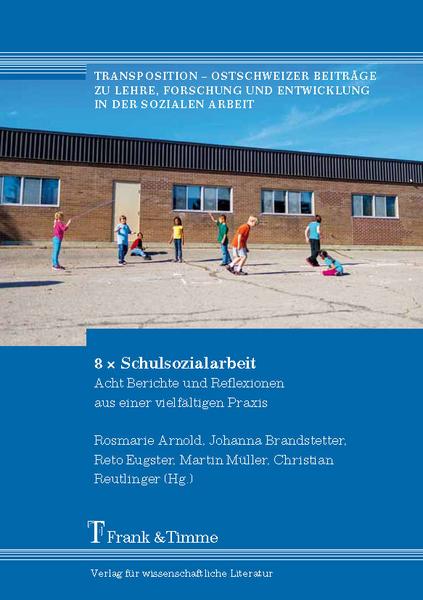Ein Gespräch der Blog-Redaktion mit dem Leiter des Weiterbildungszentrums FHS St.Gallen, Prof. Dr. Reto Eugster*, eröffnet unsere Serie Fokus. Dozierende unseres Weiterbildungszentrums kommen zu Wort. Sie nehmen als Expertinnen und Experten Stellung zu Fragen ihres Lern-Lehr-Verständnisses. (Erschienen im Bildungshorizont, 2015)
Seit Februar 2013 gibt es das neue Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen. Was sind wichtige Neuerungen?
Die bisherigen vier Weiterbildungsabteilungen, die strukturell in den vier Fachbereichen Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Soziale Arbeit verankert waren, sind Anfang 2013 in das neue Weiterbildungszentrum übergegangen. Unsere Angebote beziehen sich neu auf neun Themenschwerpunkte, beispielsweise Gesundheit, Business Administration, Public Services oder Neue Medien. Die Neustrukturierung macht klar: Uns ist eine fachbereichsübergreifende und interdisziplinäre Perspektive wichtig.
Eine solche Neustrukturierung verändert Lehr-Lern-Arrangements.
Der Fokus verschiebt sich vom Was des Lernens auf das Wie des Lernens. Wir vollziehen eine Bewegung vom Lehren zum Lernen. Damit verändern sich Erwartungen an Studierende und Dozierende. Studierende stehen am Regie-Pult ihres Lernprozesses. Dozierende sind auch Vermittler, Lotsen, Coaches, Berater usw.
Dies bedeutet, es steht Veränderung an.
Wir haben nicht erst im Februar 2013 begonnen, Lernarrangements weiter zu entwickeln. Bereits heute sind wir auf dem aktuellen Stand der Weiterbildungsentwicklung. Vieles ist geleistet. Aber es ist nicht falsch zu sagen: Wir wollen mehr erreichen.
Es stehen Investitionen in die Bildungsinnovation an?
Wir nutzen die Expertise unserer Hochschule, konkret beispielsweise des Zentrums für Hochschulbildung, um Bildungsinnovation zu forcieren. In den nächsten Jahren werden wir Zeit und Geld gezielt in Bildungsinnovation investieren. Ausgangspunkt dabei ist die Frage: Welche Lernarrangements ermöglichen optimales transferorientiertes Lernen, und wie erreichen wir gleichzeitig eine Wissenschaftsnähe, die professionelles Handeln begründet und legitimiert?
Weg vom Frontalunterricht…
… Eine Formulierung, die ideologisch schmeckt. Die Frage ist eher, welche Ziele mit welchem Lernarrangement erreichbar sind. Schulen müssen allerdings von der Vorstellung Abschied nehmen, dass nur dort gelernt werde, wo gelehrt wird. Eine Formulierung von Rolf Arnold.
Lernen an Hochschulen, da denkt man immer noch an Hörsäle, Vorlesungen …
… An eine Art von Studierenden-Beschallung? Nein, das ist weder unsere Gegenwart noch unser Ziel. Die Studierenden sind als Lernakteure angesprochen. Sie sind weniger Teil eines Lehrgangs als vielmehr Initiatorin oder Initiator ihres Lerngangs.
Dies bedeutet, dass von Studierenden der Weiterbildung mehr erwartet wird als zuzuhören, zu notieren und zu reproduzieren.
Lernen ist eine Herausforderung, eine Befriedigung, eine Chance –, aber stets auch eine Zumutung. Bewährte Denkmuster und Handlungskonventionen, „funktionierende Vorurteile“, wie Soziologen sagen, werden hinterfragt. Lernen bedeutet, von einer Haltung vermeintlicher Gewissheit zu einer Haltung der Überraschbarkeit zu kommen. Studierende müssen bereit sein, diese Lernzumutung anzunehmen. Lernen bedeutet die Entwicklung einer Lernhaltung.
Das erfordert Studierende, die mitmachen, die bereit sind, das Prozesshafte des Lernens zu akzeptieren.
Für den Spaziergänger reicht die Vorstellung der Erde als Scheibe. Für den Flugreisenden ist es von Vorteil, für den Astronauten ein Muss, die Erde als Erdball zu begreifen. Mit den Zielen – Spazieren, Fliegen, Mondbegehung – wechseln die Lernzumutungen. Nach wie vor existiert in den USA die Bewegung der Flacherdler. Sie nennt sich Flat Earth Society und setzt sich aus Zeitgenossen zusammen, die auf dem Konzept einer flachen Erde bestehen. Für sie ist eine Erde ohne Rückseite unvorstellbar.
Die Verweigerung, sich neuen Erkenntnissen zu öffnen…
… Für die akademische Welt durchaus eine verwegene Verweigerung. Das politische Ziel der Flat Earth Society besteht meines Wissens nach wie vor darin, die US-Regierung dazu zu bewegen, die Erde zur Scheibe zu erklären.
Ein Ziel, das noch nicht erreicht ist.
Die Flacherdler sind nicht bereit, sich der Zumutung von Satellitenbildern zu stellen, da diese Bilder etwas zeigen, was sich der Unmittelbarkeit ihrer Erfahrung entzieht. Meine Einschätzung ist, dass wir in Lernprozessen immer wieder zu Flacherdlern werden. Jenseits flacher Gewissheiten sind Erkenntnisse oft mühsam nur zu akzeptieren. Mit dem Wissen vermehrt sich das Nichtwissen. Am Ende eines Lehrgangs weiss ich mehr als zu Beginn, aber es öffnet sich unversehens ein Horizont neuer Fragen. Und das ist nicht die schlechte, sondern die gute Nachricht.
Hier kommt Wissenschaft ins Spiel. Wissenschaft ermöglicht, über das Faktische und über das Offensichtliche hinaus zu gelangen. Aber schadet zu viel Wissenschaft nicht der Praxistauglichkeit?
Anwendungsorientierung und Wissenschaftsnähe als Gegensatz zu denken, greift zu kurz. Es macht einen Unterschied, ob professionelles Handeln auf Gerüchten, Annahmen, Vorurteilen usw. beruht oder ob es wissenschaftliche Gründe dafür gibt. Wer ein Haus baut, tut gut daran, sich bei Fragen der Statik nicht bloss auf Gerüchte oder sein Gefühl zu verlassen, sondern geologische Theorien der Erdschichtung ernst zu nehmen.
Wissenschaft erzeugt eine Art von Wissensüberhang, der bei konkreten Anwendungen nicht gebraucht wird …
Das unterscheidet wissenschaftliches Wissen von Rezeptwissen. Wissenschaft erzeugt, gemessen an der einzelnen Anwendung, diesen Wissensüberschuss, weil sie an einer Welt-in-Bewegung ausgerichtet ist. Sie rechnet damit, dass sich Anforderungen an Handelnde laufend ändern. Deshalb geht es in der Wissenschaft weniger um Wissensbestände als um Wissenschaftsdiskurse. Durch unsere Wissenschaftsnähe ermöglichen wir Weiterbildungen, die Handelnde auf eine sich wandelnde Welt vorbereitet.
Handelnde aber müssen wissenschaftliches Wissen oft ignorieren, wenn sie entscheidungsfähig bleiben wollen.
Das Entscheiden ist immer, wie Marcel Loher sagt, eine Verzichtsplanung. Die Entscheidungsfähigkeit und die Fähigkeit, auszublenden, gehören auf eigentümliche Weise zusammen. Aber es macht den entscheidenden Unterschied, ob wissenschaftliches Wissen anwendungsbezogen als irrelevant bewertet oder ob es einfach ignoriert wird. Denken Sie an die geologische Expertise beim Hausbau.
In einer sich wandelnden Welt wird vernetztes Denken wichtig. Interdisziplinarität, ein Schlüsselbegriff…
… Als Etikette beliebt, bei der Implementierung häufig unterschätzt. Oft ist damit schlicht die Erweiterung einer beruflichen Perspektive gemeint. Wie ist es möglich, die eigenen Routinen vor dem Hintergrund „fremden“ Wissens zu reflektieren und auf neue Gedanken zu kommen. Gerade der enorme Innovationsdruck, dem ganze Branchen ausgesetzt sind, legt die Hoffnung auf den „anderen Blick“ nahe. Edison, Zuse, Berners-Lee: Sie mussten Denkkonventionen sprengen, um die Glühbirne, programmgesteuerte Rechner oder das World Wide Web zu „erschaffen“.
Was ist bei der Realisierung von Interdisziplinarität wichtig?
Als Weiterbildungszentrum ist es uns wichtig, spezifische Anforderungen von Berufen, Professionen und Branchen zu verstehen. Deshalb arbeiten wir intensiv mit Praxispartnern zusammen. Ansprüche nach „Interdisziplinarität“ können nicht meinen, diese Spezifika zu vernachlässigen. „Interdisziplinarität“ kommt dort ins Spiel, wo Probleme nicht nur kompliziert sind, sondern komplex werden. Um Probleme angehen zu können, müssen Akteure disziplinäre Bezüge nutzen und gleichzeitig über sie hinaus kommen können. Interdisziplinarität setzt disziplinäre Selbstvergewisserung voraus.
Man muss die Notwendigkeit von Interdisziplinarität erkennen können, und zwar im konkreten Anwendungsfall.
… Bei einer Betriebsbesichtigung erklärte mir der Verantwortliche, die Produktionsprozesse seien inzwischen durchgängig optimiert. Doch wenn Mitarbeiter in einer Produktionseinheit im Konflikt lebten und sich dieser in den Feinverästelungen der Kommunikation ablagere, leide die gesamte Produktion darunter. Die Optimierung der Produktionsprozesse ist ein Geschäft, bei dem Prozessexperten unverzichtbar sind. Darüber hinaus zeigt sich, dass hier eine hochspezifische soziologische Expertise relevant ist. Während die einen Konflikte als Unfälle sehen, sind sie für die anderen Normalfälle der Kommunikation. Der Wechsel der Perspektive eröffnet neue Handlungsoptionen.
Mein Eindruck ist, dass Experten oft zu wenig über die Optionen anderer Experten wissen.
Das Problem der Interdisziplinarität ist, dass man nicht weiss, was man nicht weiss. Und so weiss ich oft nicht, dass es jemanden gäbe, der wüsste, wie mein Problem zu lösen wäre. Oder der mindestens glaubt oder glauben machen will, es zu wissen…
 Seit einigen Wochen beschäftige ich mich wieder mit Weblogs, die thematisch im Umfeld des Wissenschaftsbetriebs (bzw. von Hochschulen) angesiedelt sind. Anlass dafür ist ein Artikel, den ich für ein WordPress-Magazin verfassen kann. In einem Artikel von 2001 versuchte ich bereits „das Wesen“ des Blog-Genres zu ergründen. Nun, inzwischen hat sich einiges an meiner Einschätzung verändert. Im Folgenden mein aktueller Versuch zur Vermessung dieses Genres.
Seit einigen Wochen beschäftige ich mich wieder mit Weblogs, die thematisch im Umfeld des Wissenschaftsbetriebs (bzw. von Hochschulen) angesiedelt sind. Anlass dafür ist ein Artikel, den ich für ein WordPress-Magazin verfassen kann. In einem Artikel von 2001 versuchte ich bereits „das Wesen“ des Blog-Genres zu ergründen. Nun, inzwischen hat sich einiges an meiner Einschätzung verändert. Im Folgenden mein aktueller Versuch zur Vermessung dieses Genres.