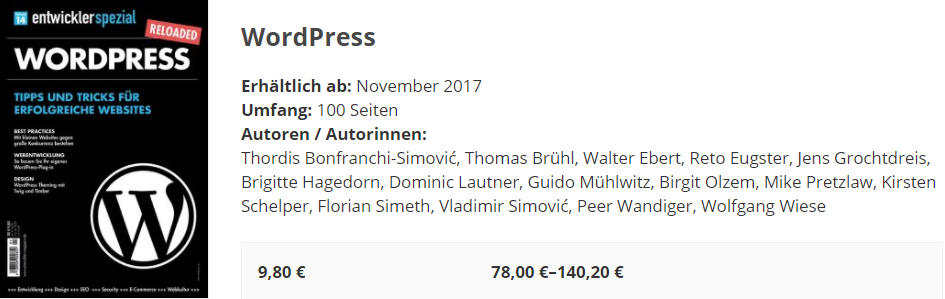Die Berner Zeitung widmet sich heute der Frage, inwieweit „digitale Assistenten“ älteren Menschen die Alltagsbewältigung zu vereinfachen vermögen. An diesem Artikel konnte ich mitwirken. Meine umfassendere Einschätzung in einer notizartigen Zusammenfassung:
Das Smartphone ist daran, zum allgegenwärtigen, mehrdimensionalen Alltagsassistenten zu werden. Unterstützung gibt es beispielsweise via Einkanal-EKG ebenso wie bei der Justierung von Haustechnik, der Navigation durch die Stadt oder beim Einkauf. Meines Erachtens werden in einer nächsten Phase in drei Bereichen Nutzungspotenziale entstehen, die für ältere Menschen von spezieller Bedeutung sein können:
a) „Selbstvermessung“, gesundheitsrelevantes Monitoring (z.B. kardiologische Anwendungen, die heute schon angeboten werden).
b) Notfallsysteme, die intelligenter werden und in schwierigen Situationen bereits ein „punktgenaue“ Triagierung an die richtige Stelle vornehmen.
c) Soziale Kontakte werden im Zuge der so genannten „Messengerisierung“ einfacher („intelligenter“) lebbar, gerade bei älteren Menschen, die in ihrer physischen Mobilität (teil-)eingeschränkt sind. Stichwort: Messenger mit intelligenten Assistenzfunktionen, Navigationssystemen usw.
Inwieweit solche Lösungen die nötige Akzeptanz finden, ist zentral von vier Faktoren abhängig (hier als Zuspitzung und Zusammenfassung):
- vom sozialen Milieu: Die Bereitschaft zur Aneignung von Kulturpraktiken ist milieugeprägt;
- vom Vorhandensein einer Mittlerperson (Familienmitglied, Kinder, Freund, Freundin usw.);
- von der Nützlichkeitserwartung (bzw. von der Plausibilisierung der Nützlichkeit im sozialen Nahbereich);
- von der Einfachheit der Nutzung.
Nehmen wir die generelle Akzeptanz des Internets bei den älteren Generationen als Indikator, so stellen wir fest, dass wir es in den letzten Jahren mit einer deutlichen Akzeptanzzunahme zu tun haben. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Zunahme bei der Smartphone-Nutzung. Knapp drei von zehn Seniorinnen/Senioren ab 65 besitzen und nutzen ein internetfähiges Smartphone (Deutschland, 2016).
Zum Artikel in der Berner Zeitung: Mittlerweile bin ich nicht mehr Leiter des Kompetenzentrums Generationen der FHS St.Gallen, sondern Leiter des interdisziplinären Weiterbildungszentrums.
Zum Artikel in der Berner Zeitung…