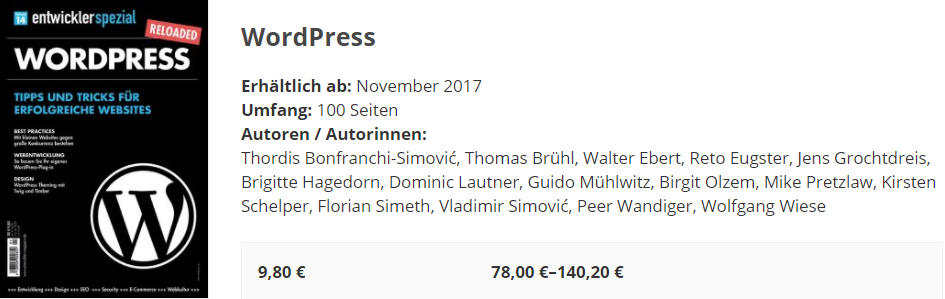In dieser Woche unterrichte ich wieder im Lehrgang Medienpädagogik (CAS, Fachhochschule). Seit rund zehn Jahren bin ich im Dozierendenteam dabei. Im Rahmen meines Seminars führe ich in drei grundlegende medienpädagogische Positionen ein, um aktuelle Debatten einordnen zu können:
- Position 1: Schutzräume errichten
- Position 2: Resilienz stärken und mit Eigenentwicklung rechnen
- Position 3: Medienentwicklungen und -ereignisse als pädagogische Anlässe nutzen: dialogisch-mediensensitive Pädagogik.
In politischen Debatten wird oft Position 1 vertreten. Es soll gefiltert werden, wo immer möglich. Diese Position ist deshalb politisch ergiebig, weil sie 1) alltagslogisch umstandslos einzuleuchten scheint und 2) stets „die anderen“ adressiert: Plattformen, Messenger-Anbieter usw. Zwei Kriterien, welche den politischen Diskurs als solchen ausweisen. Es soll simpel sein und die anderen mit Handlungserwartungen adressieren.
Doch das Konzept des „Schutzraums“ ist allein deshalb oft problematisch, weil es kaum zu verwirklichen ist und den Anforderungen, die sich an Pädagogik stellen, nicht gerecht werden kann. Dabei stehen nicht primär technische Probleme im Vordergrund, obwohl sie nicht zu unterschätzen sind, sondern soziale. In der Schule beispielsweise wird die Unterschiedlichkeit der elterlichen Zugangsregelungen „zum Problem“, sobald versucht wird, Position 1 zu realisieren. Oder wie meine Kollegin sagt, die als Lehrerin tätig ist: Einer/eine in der Klasse hat immer den „Schlüssel“ zur Türe in den „Abgrund“.
Dies bedeutet: Es bräuchte eine mediensensitive Pädagogik, die mit Medienmilieus rechnet und mit Kompetenzsymmetrien zwischen Jugendlichen und pädagogischen Akteuren. Vom politischen Personal kann selten Unterstützung erwartet werden, dies zeigen konkrete Erfahrungen der letzten Jahre. Das Anliegen muss meines Erachtens sein, Kompetenzen hin zu einer mediensensitiven Pädagogik zu entwickeln (nicht bloss zu einer „Medienpädagogik“) , die zu mehr fähig ist als zu: „Ich filtere, also bin ich“.