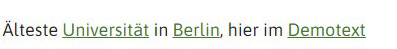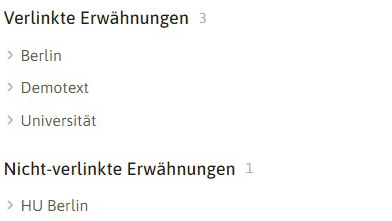„Heute kippt das ganze System in die Unbestimmtheit, jegliche Realität wird von der Hyperrealität des Codes und der Simulation aufgesogen.“ (9)
„Agonie des Realen“„Die Moderne ist keine Umwertung aller Werte, sondern eine Austauschbarkeit aller Werte… “ (162)
Jean Baudrillards Buch Der symbolische Tausch und der Tod ist 1976 erschienen und zählt zu seinen bedeutenden Werken. Es besteht aus Essays, die sich lose aufeinander beziehen. Bereits in seiner Dissertaton 1968 – Das System der Dinge (Le Système des objets) – legte Baudrillard die Basis für seine Konzepte des Hyperrealen. Die Simulationsgesellschaft, geprägt durch die dramatische Fetischisierung der Zeichen – oder mit Martin Horacek (2007, 144) präziser formuliert:
„Der Warencharakter der industriell erzeugten Produkte wird für Baudrillard abgelöst von einer Fetischisierung der Objekte in einem selbstreferentiellen Zeichenuniversum.“
Baudrillard, schillernde Persönlichkeit, streitbar und unerschrocken, ist 2007 in Paris gestorben. Er wurde 78 Jahre alt. Josef Rauscher über „Requiem für die Medien“, vielleicht generell auf Baudrillard anwendbar:
„Unlesbar, wenn man nicht hartnäckig gegen ihn mitdenkt“.