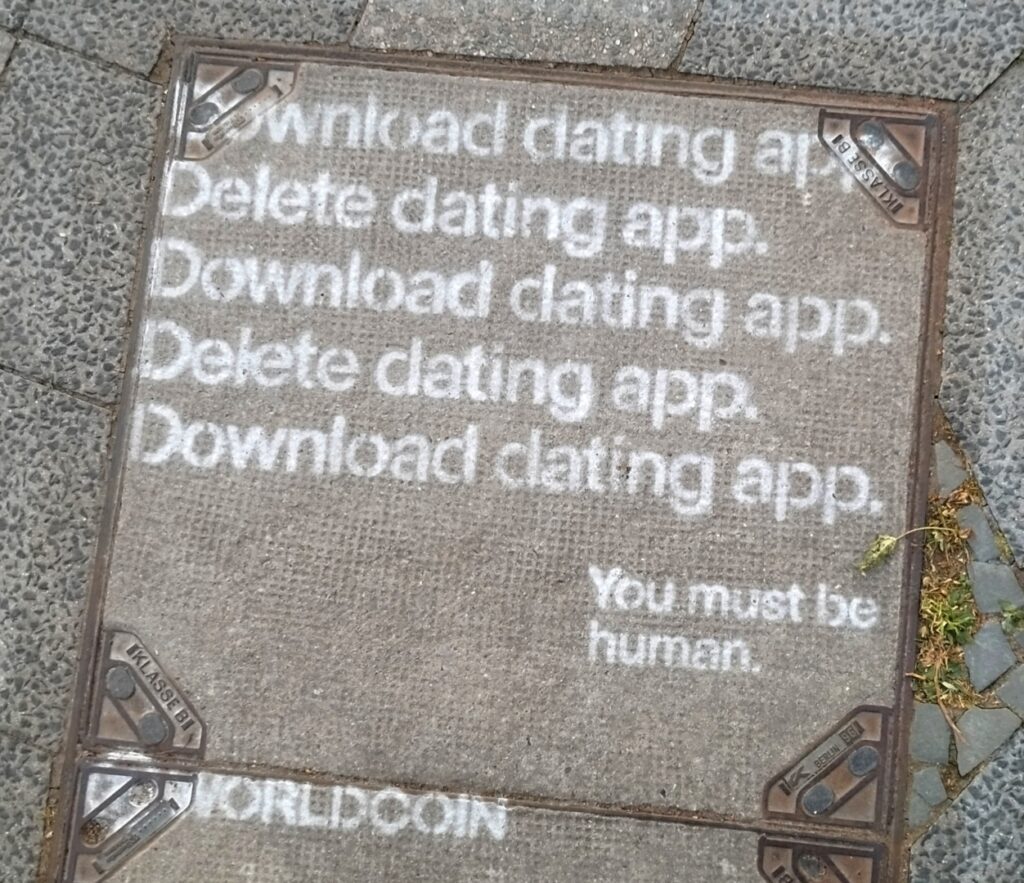„Die Häuser, die sie bewohnen, sind sauber wie sie selber, die Strassen, die sie bauen, sind ein bisschen holperig, genau wie sie selber, und das elektrische Licht, das ihre Dorfstrassen Abends beleuchtet, ist praktisch, wiederum exakt wie sie selber.“ (Der Gehülfe)

Heute, am arbeitsfreien Tag, Besuch bei Robert Walser, Friedhof Herisau, Appenzellerland: Walser hat in dieser Gegend lange Spaziergänge unternommen. Beim Spaziergang am Weihnachtstag 1956, allein unterwegs, ist er infolge eines Herzschlages zusammengebrochen und gestorben, begraben im Schnee.
Ausgereichnet im Schnee. Viele seiner Texte sind dem Schneien gewidmet. Und seine Werk Der Spaziergang ist meines Erachtens ein Monument moderner Literatur, auch wenn sich ein solcher Begriff bei Walser fürs Erste verbietet, dem Verkleinerungskünstler. Ob seiner Sprache verschlägt es mir die Sprache…
1933 wurde Robert Walser gegen seinen Willen in die „Heilanstalt“ Herisau, in die Psychiatrie, eingewiesen und beendete seine literarische Tätigkeit. Er lebte 23 Jahre in der Klinik Herisau, zuvor rund vier Jahre in der Klink Waldau in Bern.